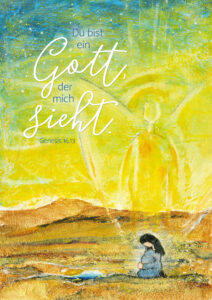(von Pfarrer Dr. Gerhard Wenzel)
Die Gnade und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen
Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
„Wir danken Dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist“ haben wir eben gesungen. „Jesus hat ein Opfer gebracht. Er hat sich selbst geopfert“, sagt die kirchliche Lehre. So wurde sein Leidensweg und sein Tod rückblickend, also im Nachhinein, interpretiert. Wer kann und darf so etwas über den Leidensweg oder den Tod Anderer sagen? Große Kollektive, wie die unterschiedlichsten Staaten, scheinen das für sich jedenfalls gerne in Anspruch zu nehmen. „Eure Söhne sind für das Vaterland gestorben“ wurde damals den Müttern während des Ersten und Zweiten Weltkriegs gesagt. Und auf den Gedenkstelen stand es dann auch ewig in Stein gemeißelt drauf: Sie haben sich für das Vaterland geopfert. Und das ist ja nicht alte Denke, von der man sich längst verabschiedet hätte. Nein, immer wieder muss das Leben Einzelner hehren Zielen oder Zielen von Heeren dienen und wird ihnen geopfert. Im Falklandkrieg 1982 sind die Söhne den Opfertod für das Vereinigte Königreich gestorben. Tatsächlich verschwand mit dem Krieg die argentinische Diktatur, die der eigentliche Aggressor bei den Inselkonflikten war. Trotzdem haben sich die jungen Menschen, die tausende Kilometer entfernt in Großbritannien lebten und damit nichts zu tun hatten, diesen Opfertod nie gewünscht.
Immer wieder müssen Söhne oder Töchter als Opfer herhalten. Auch, dass da nun ein paar Menschen nach der Impfung durch den Impfstoff mit Astra Zeneca durch die Bildung von Blutgerinsel gestorben sind, wird da schnell in der allgemeinen Todesstatistik eingeordnet (nach dem Motto: das ist nur Zufall, dass die in der Zeit gestorben sind) oder aber eben als notwendiges hinzunehmendes Opfer interpretiert, denn genau so wird es begründet – es würden ja viel mehr sterben, würde man den Impfstoff nicht verabreichen. Und nun gehen die Impfungen mit diesem Impfstoff munter weiter, abgesegnet von einer europäischen Institution.
Ich bin sicher, dass die Eltern der geimpften und eine Woche später unter 50 Jahren verstorbenen Krankenschwester aus Norwegen oder die Eltern der geimpften und ebenso verstorbenen Mitdreißigerin, die in Norwegen im Gesundheitswesen arbeitete oder aber die Eltern der drei jungen italienischen geimpften und ebenso wenige Tage später verstorbenen Soldaten ihre Töchter und Söhne nicht geopfert wissen wollten, ebenso wenig wie die Eltern von Jesus, also Josef und Maria ihn geopfert sehen wollten.
Das Leid und der Tod stellt sich für die unmittelbar Betroffenen immer anders dar als für die, die nicht unmittelbar betroffen sind.
Für seine Mutter Maria und seinen Vater Josef war Jesus, als er mit seinen noch nicht einmal dreißig Jahren gewaltsam starb, immer Kind geblieben. Und als Maria am Kreuz stand, weinte sie um ihr geliebtes Kind, nicht um den Gottessohn. Die Rollen, die Jesus in seinem Leben übernahm, die Aufgabe, die er ausfüllte, dürfte für sie zweitrangig gewesen sein. Folter ist Folter, Kreuz ist Kreuz und Tod ist Tod.
Und Jesus selbst dürfte sich ebenso wenig darauf gefreut haben, Opfer zu werden. Dagegen spricht nicht nur sein Beten im Garten Gethsemane, wo überliefert ist, dass er darum gebeten haben soll, dass dieser Kelch an ihm vorüber gehen möge, sondern auch das Psalmzitat aus seinem Munde am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“
Opfer geschehen immer wieder, werden immer wieder gefordert und erwartet. Aber damit wird eigentlich das Leid und der Tod von Menschen nur im Nachhinein gerechtfertigt und geheiligt. Man schließt Frieden mit der Gewalt oder dem Leid und versucht es in irgendeinen Sinnzusammenhang einzuordnen, obwohl es eigentlich sinnlos ist.
Die Leidensankündigung Jesu, wie wir sie vorhin in der Lesung hörten, mag von solchem Bedürfnis herrühren, den Leidensweg und Tod Jesu in so ein Sinngefüge einzuordnen, ihn also förmlich als göttliches Opfer zu stilisieren. Da würde es dann um seine Rolle als Christus, als der von Gott gesandte Messias und Retter der Welt gehen.
Aber man kann die Leidensankündigung auch einfach hören als gesprochen aus der Perspektive des Menschen Jesus selbst. Jesus sieht das Unheil auf ihn zukommen. Er nimmt die Neider und intriganten Absichten der Menschen um ihn herum wahr. er sieht den Hass und den Fanatismus und den Einfluss der Mächtigen. Er spürt deutlich, was das für ihn bedeutet und zur Konsequenz haben wird. Er leidet daran und hat seinen weiteren Leidensweg vor Augen. Und als Petrus das nicht wahrhaben will, raunt er ihn an: „Geh hinter mich, du Satan! Denn du hast nicht im Sinn, was göttlich ist, sondern was menschlich ist“.
Ja, in der Tat ist es menschlich, dass wir uns ein leidfreies Leben wünschen würden wie Petrus. Ein Leben ohne Verletzungen und die Grenze des Todes und ohne all die anderen Grenzen, die wir als Menschen erfahren. Petrus, der sich eben noch zu Jesus als Christus, als den mit Gott besonders verbundenen Gesandten bekannte, also als dem lang ersehnten und erhofften Messias, der erweist sich nun als Verdrängungskünstler pur. Und das nennt Jesus satanisch deshalb, weil es ein Versprühen von Illusionen ist – ein Benebeln, wie es all diejenigen tun, die uns vorgaukeln, das Leben sei nur immer toll und Jugend und Schönheit sei ewig und wenn wir die entsprechende Tagescreme nehmen, dann bliebe das auch so. Nein, unser Leben ist schon immer durchkreuzt, gezeichnet und begrenzt durch Leid und Tod, ja, es ist ständiger Begleiter unseres Lebens, so schwer das zu fassen ist.
Ich kann Jesus verstehen, wie ihn das ärgert, dass Petrus wegschauen will, das alles nicht sehen will und wie unrealistisch seien Einschätzung der Lage ist, auch wenn die Sehnsucht nach dem Heilen und Unbegrenzten allzu menschlich ist.
Die Bibel erzählt uns gerade von Menschen, bei denen nicht immer alles glatt geht und alles easy ist. Es sind Menschen, die dann auch mal gern von anderen übersehen oder gar bewusst gemieden werden. Jesus erlebt das ja hier ansatzweise schon mit Petrus so.
Aber das Leid ist da. Es begleitet das Leben und geht nicht dadurch weg, dass wir es einfach ausblenden wie Petrus es tut. Ich habe vor Augen Menschen, die ihre Kinder gerade verloren haben. Menschen, denen alles genommen ist. Ich denke besonders an die Menschen in den unterschiedlichsten Ländern dieser Erde, wo krieg oder Diktatur und Gewalt an der Tagesordnung sind und die ihre Söhne und Töchter, ob als kleine Kinder oder Ausgewachsene tot von den Straßen aufsammeln müssen und für die das Erlebte die Hölle sein muss. Ich habe auch vor Augen Eltern, die ein Kind durch Fehlgeburt verloren haben. En betroffener Vater hatte mir mal gesagt: „Ich kann an keinen Gott mehr glauben. Dafür ist mir zu viel genommen worden. Meine Mutter in verhältnismäßig jungen Jahren und auch ein Teil der Großeltern vor kurzem und nun das – meine Tochter. Mir ist so viel genommen worden.“
Damit sind wir bei Hiob gelandet und dem Bibeltext, der für den heutigen Sonntag eigentlich als Predigttext aus dem gleichnamigen biblischen Buch vorgesehen ist.
Das Buch Hiob erzählt von Hiob und seiner Frau, die Schweres erleben müssen. Auch Hiob und seiner Frau wurde alles genommen. Anfangs nur der Besitz, dann die eigene Gesundheit und schließlich die Kinder. Für mich ist seine Geschichte eine der wichtigsten Geschichten der Bibel, weil sie ehrlich und tröstlich zugleich ist – traurig, ja anstößig und hoffnungsvoll zugleich.
Hiob war ein gottgläubiger und wohlhabender Großgrundbesitzer. Ja, man würde sagen einer, der richtig erfolgreich war und einer, der das Glück für sich gepachtet zu haben schien. Argwöhnisch sagte die ein oder andere Stimme auch: „Der ist doch nur so stark gottgläubig, weil es ihm so gut geht. Wenn der mal seinen Besitz verlieren sollte, da sieht das bestimmt ganz anders aus“. Und tatsächlich, so erzählt die Geschichte weiter, Hiob verlor von heute auf Morgen all seinen Besitz, seine vielen Tiere und Felder. Diebstahl, Unwetter und Feuer hatte all das genommen. Aber nicht nur das, ihm und seiner Frau wurden schließlich auch die eigenen Kinder durch eine Naturkatastrophe genommen und sie selbst wurden durch Krankheit geschlagen.
In Kapitel 19 setzt Hiob sich mit seinen Freunden auseinander, die ihm sagen, dass das alles von Gott käme und eine Strafe sei. Es gab jedoch kaum jemanden, der so gottesfürchtig war wie Hiob. Es gab definitiv nichts, wofür ihn Gott hätte bestrafen müssen.
Und so wehrt sich Hiob mit Recht gegen diese Deutung seines Erlebten. Er benennt einfach noch einmal sein Leid, aber anstatt zu sagen: „Gott hat mir das angetan“ oder es als eine Strafe Gottes zu deuten, sagt er einfach nur Worte, auf die ich nachher noch einmal zurückkommen möchte, und zwar: „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben.“ Ein Ausdruck des Vertrauens auf Gott in und trotz allem Erlebten.
Der Besitzverlust war das eine. Schwerwiegender war der andere Verlust: Mit den Kindern wurde Hiob und seiner Frau wirklich etwas genommen; so haben sie es empfunden und die Tatsache, dass beide krank wurden, war zwar für sich genommen ein weitere Plage, aber im Grunde nur eine logische Folge des großen Schmerzes. Das Leid war unendlich groß und bitter Beide. Sie erlebten ihre totale Ohnmacht und brachen in entsprechende Klage aus. Aber sie gingen unterschiedlich mit dem Erlebten um. Während seine Frau zu Hiob sagte, dass er sich doch endlich von Gott lossagen möge, der ihnen ihrer Meinung nach all das genommen hätte, und sie alles so unerträglich empfand, dass sie vorschlug, den Freitod zu wählen, wollte Hiob von Gott nicht loslassen. Aber der Schmerz, die Not und die Klage war beiden gemeinsam.
Auch Hiob war also wie der von mir vorhin erwähnte Kindesvater ein Mensch, dem der Erzählung nach, alles genommen wurde und der sich schwer tat, noch an Gott zu glauben, ihm noch zu vertrauen.
Es war für mich nicht das erste mal, dass ich Menschen in solchen Situationen begleite. Aber soetwas wird nie zur Routine – kann es nicht werden und darf es auch nicht werden.
Ich erinnere mich an etwas, was ich 1990 erlebte und vielleicht bei anderer Gelegenheit einmal erzählt habe. Ich hatte gerade mein Studium beendet, mein erstes Theologisches Examen gemacht, war noch jung an Jahren – 28 und arbeitete, um mir Geld für einen Führerschein zu verdienen und meine ersten Reisen für meine Forschungsarbeit in Berlin zu finanzieren, in Bochum am Kemnader Stausee für eine ganze Saison, also etwa ein dreiviertel Jahr im Bootsverleih und in der Bootsreparatur. Es gab dort viele Segler, die dort segelten oder an der Segelschule Kurse nahmen oder gaben. Mit einigen freundete ich mich im Verlauf der Zeit an. Ich war wohl ein Kuriosum: einer, der Pfarrer werden will, und am Stausee mit Booten arbeitet. Manche Begegnungen blieben oberflächliche Bekanntschaften, andere gingen tiefer, wie etwa die zu einem Ehepaar, das einen einzigen Sohn hatte, der 18 Jahre alt war. Die Frau war MS-erkrankt, nahm aber ihr Schicksal tapfer an und war beim Segeln voll dabei.
Eines Tages machten die beiden zwei Wochen Urlaub ohne ihren Sohn. Der blieb zuhause. Und in ihrer Urlaubszeit ereignete sich das Schreckliche. Der Sohn hatte mit anderen jungen Menschen seines Alters eine Party zuhause gefeiert. In der Nacht muss sich dann das Haus durch eine liegen gebliebene, nicht ausgelöschte Zigarette oder Kerze entzündet haben. Das ganze Haus brannte ab. Alle konnten dem Feuer entkommen, nur der Sohn nicht. Er verbrannte. Die Eltern hatten nicht nur ihr Haus von heute auf Morgen verloren, sondern auch ihren einzig geliebten Sohn, den ich ebenso gut kannte.
Die Eltern wandten sich an mich mit dem Anliegen, ich möge doch die Trauerfeier durchführen oder zumindest die Rede halten. Da war ich nun herausgefordert mit meinen 28 Jahren, ohne jegliche Ahnung, was es bedeutet, einen Sohn zu verlieren. Mit dem dortigen Pfarrer gestaltete ich die Trauerfeier gemeinsam und hielt die Rede in einer Kirche vor etwa zweihundert Trauergästen, die alle mit Wut, Entsetzen, Mitgefühl und Trostbedürfnis zugleich dort versammelt waren. Die Eltern immer noch im Schockzustand. Was konnten da meine Worte sein? Warum hat der gute Gott sich nur mich ausgesucht? Wäre ich doch nie an den Stausee gegangen! Ich musste reden und war doch eigentlich viel zu unbedarft. Wie Petrus hätte ich gern gehabt, dass das am liebsten alles gar nicht geschehen wäre. Und ich fühlte mich ähnlich ohnmächtig und hilflos wie die Eltern. Was sagen?
Orientierung und Worte fand ich damals im Buch Hiob.
Hiob klagte Gott an. Er nahm ihn sich zur Brust, so würde man es wohl sagen. Er lief nicht weg vor ihm, sondern sprang ihm förmlich mit seinen Klagen ins Gesicht. Zurecht hat er die von ihm erlebte Ungerechtigkeit benannt, dass er und seine Frau so viel erleiden müssen, dass ihnen so viel genommen wurde, wo er sich doch gar nichts hat zu Schulden kommen lassen und im Gegensatz zu so viel anderen Menschen, immer die Gebote Gottes geachtet hat wie kaum ein anderer.
40 Kapitel lang passiert in dem Buch, das diese Geschichte in der Bibel erzählt, von Gott aus gar nichts. Hiob klagt nur immer weiter und immer wieder, aber Gott gibt keine Antwort. Hiob erlebt echte Gottesferne. Gott wird ihm völlig fremd. Und er wird unsicher, ob er ihn jemals richtig gekannt hat. Seine Freunde sind ihm keine guten Ratgeber. Sie meinen, es sei alles Gottes Strafe für irgendwas, was er an Bösem getan habe und dass das schon alles seinen Sinn habe. Hiob hingegen beteuert zu recht immer wieder seine Unschuld und die Sinnlosigkeit des Ganzen.
Erst am Ende, nach 40 Kapiteln des Schweigens. Ich weiß nicht, ob es vierzig Tagen oder vielleicht sogar vierzig Wochen, Monaten oder Jahren entspricht, meldet sich Gott der Geschichte nach zu Wort. Und mich berührt, was Gott ihm da sagt. Also jedenfalls das, was die Geschichte erzählt, was Gott da gesagt hätte. Das erste ist: Er nimmt die Klage Hiobs auf. Er beschönigt nichts, oder kommt mit billigen Vertröstungen und erzählt Hiob schon mal gar nicht, dass der Tod der Kinder ein unvermeidliches oder aber gar notweniges Opfer war, wie das andere gerne tun. Er stellt sich vielmehr dem Schmerz und der Klage Hiobs, lässt sie gelten. Ja, den Freunden droht er sogar Bestrafung an, weil sie angeblich so schlecht von ihm geredet hätten. Und das Zweite ist: Neben der Solidarität mit Hiobs Klagen und seinen Zweifeln und Fragen, hört Hiob und hören damit auch wir eine inhaltliche Antwort auf das Klagen und Fragen Hiobs. Gott fragt Hiob nicht nur zurück: Hast du etwa diese Welt mit all ihren Lebewesen geschaffen – das könnte man ja noch negativ als Belehrung auffassen und denken, er wolle Hiob klein machen. Aber keineswegs. Er stellt nämlich dann seine zweite viel entscheidendere Frage: Und bist Du im Kampf mit den wilden Tieren? Mit den Ungeheuern und dem Ungeheuren in dieser Welt? Ich bin es tagtäglich seit Erschaffung der Welt.
Was will diese Antwort besagen? Sie will Hiob und uns der Solidarität Gottes versichern, aber nicht nur vermitteln, dass Gott gleichermaßen an dieser Welt leidet wie wir, sondern uns auch die Botschaft zukommen lassen, die die einzig wirklich Tröstliche ist: Ich bin mit Euch im Kampf für das Leben!
Dieser Kampf um Leben und Hoffnung ist Gottes stetiges Mühen, wie es auch unser stetiges Mühen ist und wir aber leider auch unsere Grenzen, die Grenzen der Medizin und die Grenzen des Lebens auf der Welt dabei erfahren.
Glauben heißt: mit den Widrigkeiten und Widersprüchen und Anfechtungen und Begrenztheiten des Lebens in dieser Welt leben lernen. Und da hält Gott selbst mit uns sehr viel aus. Die Geschichte von Jesu Leidensweg und seinem Kreuz, die wir nun gerade in dieser Zeit vor Ostern wieder erinnern, macht ja deutlich: Gerade da schaut Gott nicht weg. Er hält mit uns aus. Er ist bei uns in unserem Schmerz und unserer Not, weil es ihm selbst so vertraut ist. Er leidet an unserer Welt wie wir es auch tun und weiß, da hilft kein billiger Trost.
Ich persönlich glaube nicht an einen Gott, bei dem wir so etwas wie Marionetten sind. Ich glaube auch nicht an einen Zaubergott, der alles gut machen kann oder alles zurückgeben kann, was verloren ist. Ich glaube nicht an einen solchen allmächtigen Gott. Das ist ein Märchen aus uralten Zeiten. Aber ich glaube an einen barmherzigen Gott, einen solidarischen Gott, der mit uns mitfühlt und der uns als Menschen glücklich sehen will. Und da ist es ein starker Gedanke, dass Gott nicht nur mitfühlt, sondern, wie es hier bei Hiob zum Ausdruck kommt, schon lange im Kampf für das Leben und auf der Seite des Lebens ist.
Die Bibel sagt damit: Menschen, die Ihr Eure Kinder verloren habt. Ihr gehört zu diesem Hiob, Ihr gehört zu diesem Jesus Christus. Aber noch wichtiger: Ihr gehört zu diesem Gott Hiobs zu diesem Gott Jesu, der im Kampf für das Leben ist.
Und so erscheint das in Kapitel 19 zwischenzeitig von Hiob ausgesprochene Bekenntnis nun nicht als ein Bekenntnis, von jemandem, der im Glauben nie gewankt ist, so viel Unheil auch auf ihn einstürzte, sondern als ein Bekenntnis von jemandem, wo wir ganz ähnlich ausgedrückt finden, dass Gott im Kampf ist: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben.“ Erlösung ist dabei kein einmaliger Akt. Das hebräische Wort, das da im Urtext steht, heißt eigentlich Anwalt – „Ich weiß, dass mein Anwalt lebt.“ Gott ist ein Anwalt der Gerechtigkeit, des Friedens und des Lebens. Dafür setzt er sich permanent ein und das ist manchmal die einzige Hoffnung derer, die kein Sprachrohr oder keine Lobby haben und ungehört bleiben. Das sind auch die Irren, die in der Corona-zeit in die Kirche gehen. So werden wir inzwischen von der Mehrheit der Bevölkerung gesehen – als Irre, nicht als Gläubige. Das kann man im Internet nachlesen unter den Meinungsäußerungen, wie Menschen über Kirchenbesucher denken, insbesondere Kirchenbesucher in Corona-Zeiten.
Die Geschichte von Hiob erfährt außer dieser Antwort Gottes, in der er seine Solidarität mit Hiob und allen Leidenden bekundet, auch noch mal auf andere Weise eine Wendung.
Das Verlorene, das Genommene wird Hiob und seiner Frau nicht zurückgebracht. Aber Hiob und seine Frau erfahren noch einmal neu, das Glück, Kinder zu haben. Die Töchter, die ihnen geboren werden, benennen sie mit Blumennamen, um damit ihrer eigenen Hoffnungsgeschichte Ausdruck zu verleihen und der Hoffnung, an der Hiob trotz aller eigenen Verzweiflung nicht loslassen wollte, dass Gott auf der Seite des Lebens und nicht des Todes und der Zerstörung steht. Die Blumennamen verweisen uns auf den Frühling Gottes, auf Ostern und vielleicht denken wir einmal an diese Geschichte Hiobs, wenn wir bald die ersten gelben Osterglocken draußen im Garten entdecken. Amen
Lied: 655, 1-4 „Aus der Tiefe rufe ich zu Dir“